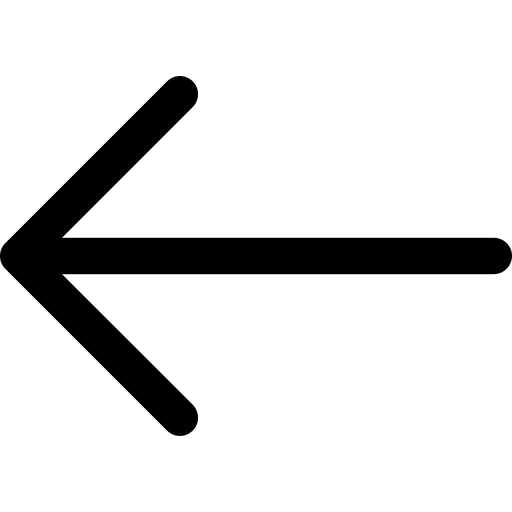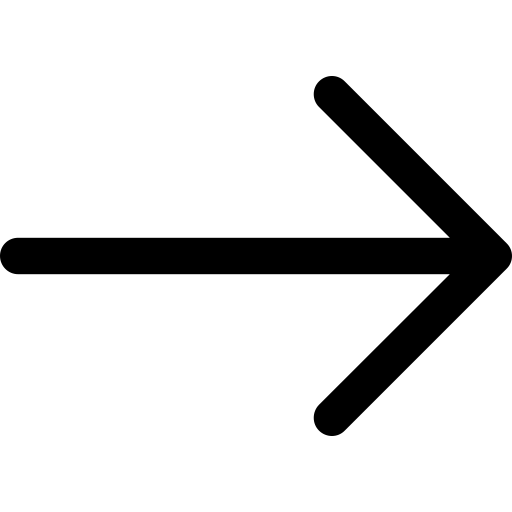Mogelpackung Infomercials
04 Februar 2026Sie kommen daher im Deckmäntelchen des Dokumentarischen, sind aber schlichte Werbefilme für ihre Protagonisten

Früchte im Filmtitel
03 Februar 2026Früchte sind nicht nur ein beliebter Lieferant für Vitamine, sondern auch für Filmtitel. Wir haben zugebissen...

KI: Bessere Recherche Prompts
01 Februar 2026Wer im Web nach bestimmten Themen sucht, kann höchst unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Die besten Rechercheprompts...

Historische Krimis
30 Januar 2026Historische Verbrechen und deren Aufklärung sind zentraler Plot in einigen spannenden Kinofilmen und Serien